|
| ||

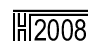




In der neuen Vorliebe für Präsentationen treffen aktuelle gesellschaftliche und pädagogische Entwicklungstendenzen aufeinander. Präsentationsunterricht nämlich fügt sich dabei nahtlos ein in derzeitige (berufs-)pädagogische Megatrends wie selbstorganisierter, selbstgesteuerter, handlungsorientierter Unterricht, Gruppenarbeit und Projekt, ja er bündelt sie sogar. Präsentationsunterricht ist deshalb flächendeckend im deutschen Schulwesen anzutreffen, also auch in der Berufsschule.
Von vorfindlichen, in der Berufsschule erstellten Präsentationsprodukten ausgehend, wird im Sinne einer bildungs- bzw. zeitökonomischen Kosten- und Leistungsrechnung untersucht, welcher Wert Präsentationsunterricht in seinen unterschiedlichen Phasen (Präsentationsproduktion, Präsentationsakt sowie Präsentationsselbst- und -fremdreflexion) für die Sprachentwicklung insbesondere von Teilzeit-Berufsschülern beizumessen sein dürfte.
Vor der Gefahr eines Abgleitens in eine sprachliche Zwei-Klassen-Gesellschaft wird gewarnt.
Wer Schulflure durchstreift und Klassenräume betritt, sieht es auf den ersten Blick: In dieser Schule werden wichtige Themen bearbeitet. Plakate, Packpapierabschnitte, Flipchartbögen an den Wänden, dreidimensionale Objekte, die unterschiedlich lang (dabei selten kurz, oft überlang) die Räume füllen, legen ein beredtes, stummes Zeugnis ab: Hier finden Präsentationen statt!
Deren stummen Überbleibseln begegnet man mittlerweile flächendeckend in deutschen Schulen. Denn die Präsentation ist inzwischen nicht nur ein Teil der Abiturprüfung. Genauso ist sie eine ernst zu nehmende Angelegenheit im 1. Schuljahr geworden: „Mama, ich soll ein gesundes Mittagessen präsentieren. Hilfst du mir?” Folglich Präsentationen auch in der Berufsschule. In welchem Beruf nämlich wird nicht präsentiert? Nicht nur der Autoverkäufer muss seine S-Klasse verkaufen. Auch der Gärtner muss eine Teichanlage dem potenziellen Auftraggeber schmackhaft machen, während die Bürokauffrau die Zahlen der Kosten- und Leistungsrechnung zu präsentieren haben wird - zwar nur betriebsintern, aber immerhin. So heißt es.
Neu ist nicht, dass in der Welt der Wirtschaft Erzeugnisse und Ansichten präsentiert werden. Neu sind die unglaublichen Verfeinerungen der Präsentationen und ihre Allgegenwärtigkeit. Die ausgeklügelten Präsentationen in Produktdesign und Werbung sind hinreichend bekannt. Ganze Wirtschaftszweige leben davon. Aber auch der Wirtschaftsbürger selber muss sich auf dem Arbeitsmarkt präsentieren.
Beim Kampf um die Gunst der Zuschauer präsentieren sich Medienstars wie Schmidt, Pocher, Raab, Krömer und wie die TV-Größen alle heißen. Alsdann das Internet: Wer soll noch ernst zu nehmen sein ohne eine eigene Homepage/den eigenen Videoblog, in dem er/sie kleine, periodisch aufgefrischte Ansprachen ans Volk richtet, seine Meinung über Gott und die Welt kundtut und dabei nur einer Regel folgt: authentisch sein, bloß kein Schriftdeutsch sprechen, nichts ablesen! Nicht einmal unsere Kanzlerin ist sich zu schade für wöchentlich erneuerte Podcast-Präsentationen.
In diesem mächtigen Strom der Zeit mag Schule nicht innehalten, ihrer mit ihrem Namen fixierten Aufgabe zum Trotz ( rxzkg - schole heißt bekanntlich „innehalten”, insbesondere in der Arbeit). Festzustellen ist folglich: Ein modisches, gesellschaftliches Verhaltensmuster ist in die Schule eingedrungen, zumal gilt: Präsentationen sind selber präsentabel, damit kann sich sogar Schule selber, ehedem noch mit dem Grau des Alltags assoziiert, als bunt präsentieren, als modern, weltoffen und arbeitstüchtig. Unter Umständen kommt sie damit sogar bis in die Lokalpresse: „Kinder kämpfen gegen Klimawandel”, schlagzeilt „Der Potsdamer” am 11.7.07 und berichtet über eine Schulpräsentation: „Vor einigen Wochen wurde in der Waldstadt-Grundschule das Projekt ‘Pinguine in die Havel!' ins Leben gerufen. Die Schüler der Klasse 3a haben Transparente, Plakate und Vorträge ... in vier Arbeitsgruppen erarbeitet. Anhand der gesammelten Informationen kamen die Schüler [der 3. Klasse, wohlgemerkt!] zu dem Schluss: der Mensch ist schuld am Klimawandel.” In diesem Bericht finden wir auf engstem Raum versammelt, was in Pädagogik und öffentlicher Meinung gleichermaßen derzeit einen guten Namen hat und was wir in unsere Definition von Präsentationsunterricht aufnehmen werden: Projekt, Transparent, Plakat, eigenständiges Lernen, Gruppenarbeit & Präsentation. Wir werden darauf zurückkommen.
Selber weltfremd dürfte dagegen sein, wer den Zusammenhang zwischen allgemeiner gesellschaftlicher Präsentationslust und schulischer Präsentationsfreude in Abrede stellt. Allerdings ist mit dieser Feststellung noch keine Abwertung verbunden, denn trotz des Makels ihrer sachfremden, nichtpädagogischen Herkunft könnte die Präsentation in der Schule segensreiche Wirkung entfalten. Fest steht zunächst lediglich, dass Präsentationsunterricht anderen Unterricht, namentlich die gemeinsame, lehrergesteuerte Erarbeitung im Klassenverband, im Umfang seiner Verbreitung ersetzt bzw. verdrängt. Diese Feststellung gilt in besonderer Weise für die Teilzeitberufsschule.
Die Aufgabe, Präsentation von anderen Unterrichtsgestaltungen wie beispielsweise Referat und Vortrag abzugrenzen, bereitet einige Schwierigkeiten. Das Kind im 1. Schuljahr, das über sein Mittagessen vor der Klasse spricht und drei Bio-Möhren herumreicht: Hat es präsentiert, vorgetragen oder referiert? Und was machen die Lehrer eigentlich über weite Strecken? Ist ihr Unterricht nicht selber eine Aneinanderreihung von Präsentationen, und zwar schülerzentrierten?
Andererseits sollte Präsentationsunterricht als etwas vergleichsweise Neues abgegrenzt werden von Altbekanntem wie Vortrag und Referat. Wir werden deshalb von Präsentationsunterricht nur dann sprechen, wenn er folgende Elemente enthält: a) Eine längere, mehrere Unterrichtsstunden umfassende, relativ schülerselbstständige Erarbeitsungsphase in b) thementeiliger, nur ausnahmsweise themengleicher Gruppenarbeit, c) die Herstellung eines Präsentationsproduktes bzw. -mediums, d) die Ergebnispräsentation vor dem Rest der Klasse (in seltenen Fällen auch vor anderen Klassen, anderen Lehrern, Ausbildern o.ä.) sowie e) eine abschließende Präsentationsreflexion. Als Präsentationsprojekt mit eigenem Präsentationsprodukt fügt sich Präsentationsunterricht nahtlos ein in die derzeit angesagten, berufspädagogischen Megatrends (Stichworte: handlungsorientierter Unterricht, selbstorganisierter, selbstgesteuerter Unterricht, Projektunterricht u.a.). Ja, er bündelt sie sogar. Unterricht mit viertel- bis halbstündigen Gruppenarbeitsphasen beispielsweise, bei dem die Arbeitsergebnisse anschließend gruppenweise vorgetragen werden, ist etwas anderes und bleibt außerhalb unserer Betrachtung.
In der Berufsschule entstehen freilich eher selten sichtbare, fassbare Produkte, dort findet auch kein Kundenverkehr statt, erst recht da nicht, wo, wie im kaufmännischen Bereich, sogar in der Berufspraxis selber keine fassbaren Produkte hergestellt werden sowie der Kundenverkehr gering sein mag. Da kommen Plakate, Portfolii, Power-Point-Präsentationen u. Ä. gerade recht. Denn das sind Produkte, sie lassen sich in der Schule herstellen und anschließend präsentieren. Insbesondere von Referendaren wird deshalb erwartet, dass sie die Schüler gruppenweise Aufgaben erarbeiten (meistens auf der Grundlage von Textauszügen), Präsentationsmedien erstellen und Ergebnisse präsentieren lassen.
Die Theorie besticht: Wenn Berufsschüler in Gruppen mediengestützte Präsentationen von Fachthemen erstellen, so rücken gleich mehrere Unterrichtsziele auf einmal in greifbare Nähe: Der Unterricht findet schülerzentriert in Gruppen statt, die Präsentation und die dafür zu erstellenden Medien werden in der Vorstellung der Schüler zum Zweck ihrer Arbeit, während ihnen die Auseinandersetzung mit den Fachinhalten dabei zum Mittel wird. Diese Mittel-Zweck-Verkehrung kann die Schüler indirekt, aber wirkungsvoll für das Fachthema motivieren; außerdem verlangt dieser Unterricht von ihnen eine ständige, aktive Auseinandersetzung mit den fachinhaltlichen, gestalterischen und planerischen Vorstellungen ihrer Mitschüler. Solcher Unterricht kann daher nicht nur zu einer tieferen Verankerung der Unterrichtsinhalte führen (weil an dieser Auseinandersetzung auch Emotionen beteiligt sind; außerdem: Wer erklärt, lernt, ja er ist sich selbst der beste Schüler). Sondern solcher Unterricht leistet en passant einen Beitrag zur Entwicklung von Methoden- und sozial-kommunikativen bzw. sprachlichen Kompetenzen. Obendrein handelt es sich, wie bereits erwähnt, um eine Spielart des projektorientierten Unterrichts (für Einzelheiten s. STOMMEL 1983). Als solcher wird er derzeit per se als gut angesehen, unter anderem auch deshalb, weil er die kreativ-gestalterischen sowie die spielerischen Fähigkeiten der Schüler herausfordert.
Zur Sprachentwicklung schließlich verspricht diese Unterrichtskonzeption gleich mehrere Beiträge: In der Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe, mit dem Thema, mit seiner Darstellung für die künftigen Rezipienten sowie in der Auseinandersetzung mit ihrer Manöverkritik. Alles zusammen verspricht theoretisch die Lösung jenes entscheidenden Problems, das da heißt: Motivation. Gelernt wird, „wenn die Jugendlichen auch lernen wollen, was sie lernen sollen, und sie wollen nur dann, wenn sie den Gebrauchswert des Erklärten erkennen können” ( GRUNDMANN 2007, 8).
Da die Theorie so bestechend ist, hat man sich auf der eingangs geschilderten, breiten Front an ihre Umsetzung gemacht. Zu diesem Zweck suchen die Lehrer in einem ersten Schritt Unterrichtsinhalte aus, die besonders geeignet erscheinen für Gruppenarbeit und Präsentation. Der Unterricht konzentriert sich infolgedessen zwangsläufigerweise auf Präsentierbares; Präsentierbarkeit wird zu einem neuen Kriterium der Stoffauswahl. Es verdrängt das geborene Auswahlkriterium, das da heißt: fachlich-berufs- und/oder allgemein bildende Bedeutung. Die Folgen dieses Austauschs von Bedeutung durch Präsentation können kaum überschätzt werden. Denn was bei diesem sachfremden Auswahlvorgang regelmäßig im Fangsieb hängen bleibt, sind merkstoffartige, leicht fassbare, in möglichst gleichartige und gleichgewichtige Einzelaspekte aufspaltbare Themen. Am Berliner Oberstufenzentrum Bürowirtschaft I sind das zum Beispiel Themen wie „Arbeitsplatzgestaltung”, „Das Spiel von Angebot und Nachfrage”, „Die Säulen der Sozialversicherung”. Am Oberstufenzentrum Agrarwirtschaft lauten entsprechende Themen gerne „Dünger”, „Dachbegrünung”, „Stile der Gartenkunst” u.a.
Nehmen wir die Arbeitsplatzgestaltung. In thementeiliger Gruppenarbeit werden dabei die Aspekte Farbe, Beleuchtung, Lärm und Temperatur bearbeitet; die Arbeitsergebnisse werden auf Plakaten zusammengefasst und unter Rückgriff auf dieselben präsentiert. Gemäß Klassenbucheintragungen werden im Schnitt mindestens sechs Unterrichtsstunden für diese Arbeiten verwendet. Nun war zwar niemand von uns hier während dieser Zeit anwesend, aber die Plakate sind zurückgeblieben als stumme Zeugnisse. Sie lassen einige Rückschlüsse zu. Wie sehen und was sagen sie aus?
Auf Plakaten zur Farbgestaltung findet man ausgewählte Farben, hinter den Farben findet man drei bis fünf Wirkungen bzw. bevorzugte Büroeinsatzmöglichkeiten aufgelistet. Präsentationsmedien zur Preisbildung reproduzieren die Angebots-Nachfrage-Kurven der Lehrbücher a) bei vollständiger Konkurrenz, b) im Käufer-, c) im Verkäufermarkt und d) im Angebotsmonopol. Präsentationsmedien zur Sozialversicherung konzentrieren sich jeweils auf einen Versicherungszweig, listen dessen wichtigste Leistungen auf, enthalten den jeweiligen Beitragssatz und führen womöglich noch einige randständische, institutionenkundliche Details an wie Anzahl der Kranken- und Ersatzkassen, Anschriften von Rentenversicherungsanstalten u.Ä.
Bevor wir der Frage nachgehen, was die Schüler in den Stunden ihrer Präsentationsprojekte an Sprachkompetenz hinzuerworben haben mögen, sollten wir klären, ob die ausgewählten Unterrichtsbeispiele den Ansprüchen an Präsentationsunterricht genügen. Die Antwort lautet: Ja, sie tun es.
Denn genau so wird es auf Lehrerfortbildungsveranstaltungen als richtig vorgestellt, so z.B. auf jener, die am 22.11.07 von Lehrerfortbildnern des Berliner Landesinstituts durchgeführt wurde und an denen der Vortragende teilgenommen hat. Sie finden hier (s. Abb. 1, unten S. 13) das Merkblatt, welches die Fortbildner den Lehrern als Quintessenz mitgegeben hatten (lediglich der Verfassername wurde geschwärzt und alle Worte mit „Präsentation” hervorgehoben). Bitte stören Sie sich nicht an der Überschrift „Workshop Gruppenarbeit - So gelingt jede Gruppenarbeit”, denn alles läuft, wie unschwer zu erkennen ist, umfassend auf Präsentationsunterricht hinaus. Die Überschrift würde mithin sogar treffender „Workshop Präsentation” heißen.
Bitte beachten Sie stattdessen die Sprache der Überschrift: „So gelingt jede Gruppenarbeit”. Das ist die Sprache der Baumärkte und der Kochbücher: „So gelingt jeder Deckenanstrich”, „so gelingt jeder Sauerbraten. Man nehme...” In dieser Sprache konzentriert und manifestiert sich das derzeit in der Lehrerfortbildung vorherrschende Verständnis von Unterricht. Es lautet: Man muss ein paar Regeln beachten, dann gelingt's! Unterrichten nach Rezept! Dabei wird schlicht vergessen, dass wir es im Unterricht mit Menschen zu tun haben, nicht mit Sachen, und dass nicht alles im Unterricht erreichbar sein wird (im Beispiel: Wie gelingt wohl eine Gruppenarbeit/Präsentation zur Relativitätstheorie, zur Fotosynthese, zur Bedeutung der Kostenstellengemeinkosten für Betriebskostenabrechnung und Industriekalkulation oder auch nur zu den Gewährleistungsansprüchen aus mangelhafter Lieferung?) Das alles jedoch wird vorgetragen im Rahmen jener Lehrerfortbildungen, die ansonsten nicht müde werden, die Individualisierung des Unterrichts anzumahnen! Solche Fortbildung ist Rückbildung, streckenweise gar bis ins Kindische, und die Sprache verrät es. Aber: Wer als Lehrer solche „Fortbildung” duldsam über sich hat ergehen lassen, der bekommt von seinem obersten Dienstherrn laufbahnfördernd auf blütenweißem Papier (nicht dem üblichen, dienst- bzw. ökograuen) beurkundet, sich um den neuesten Stand des Lehrens und Lernens bemüht zu haben.
Doch zurück zu den Unterrichtsbeispielen. Was haben die Schüler bei der Produktion der Präsentation in den jeweils durchweg mindestens sechs Unterrichtsstunden gelernt? Im Detail werden wir die Antwort schuldig bleiben müssen, denn wir waren ja nicht dabei. Im Großen und Ganzen wird man aber feststellen können: Herzlich wenig für die lange Zeit.
• Um sich der auf den Plakaten skizzierten Wirkungen der Farben zu vergewissern, bedarf es etwa einer Unterrichtsstunde. Aus meiner [AS] langjährigen Unterrichtspraxis als Lehrer für Warenverkaufskunde Glas/Porzellan/Keramik (dort besitzen Farbwirkungen eine höhere berufspraktische Bedeutung als für Bürowirtschaftslehrlinge) fühle ich mich zu dieser Einschätzung befähigt - schließlich haben sich alle Schüler mit diesen Fragen schon oft privat (Kleidungsauswahl) und schulisch (im Kunstunterricht) befasst.
• Angebots-Nachfragekurven verstellen eher ein grundlegendes Verständnis für wirtschaftliche Prozesse, weil sie die Produktionskosten systematisch ausblenden - eine fachwissenschaftliche Erörterung wäre hier jedoch fehl am Platz.
• Die spannenden Fragen der Sozialversicherung, die in der Schule zu behandeln sind, beziehen sich nicht auf Beitragssätze und Leistungskatalogauszüge (dafür braucht man keine teure Schule, die Antworten müssen eh immer aktuell ermittelt werden und sind leicht zugänglich). Die spannenden, nicht so leicht zugänglichen und deshalb in dem für solche Aufgaben eigens geschaffenen (Ruhe-)Raum der Schule zu behandelnden Probleme sind grundlegender Art und betreffen Probleme wie die Beitragsbemessungs-/ die Versicherungspflichtgrenze und ihrer sozio-ökonomischen Wirkungen, die Belastbarkeit der Versicherten, die Alternative einer Steuerfinanzierung, die Allgemeingültigkeit des schweizer Prinzips („Der Millionär braucht nicht die Rentenversicherung, aber die Rentenversicherung braucht den Millionär”, hallt es dort durch Berg und Tal), die Alternative „Umlagefinanzierung oder Kapitaldeckungsverfahren?”, die nur scheinbare Trennung der Beiträge in Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, die „Lohnnebenkosten”-Senkung und manches mehr. Nichts dazu ist auf den Präsentationsprodukten zu finden, obwohl man bei mehr als sechs Unterrichtsstunden mit angemessenen Methoden nachweislich eine Menge dazu erarbeiten kann, vorausgesetzt, der Lehrer hat die Sachverhalte selber durchschaut - eine Voraussetzung, die leider nur selten erfüllt ist. Hier wird Sprachförderung zu einer Aufgabe der Lehrer fach bildung.
Regelmäßig stehen wir also vor einer Ansammlung plakativer Oberflächlichkeiten, vor Plakativem eben (sowie vor Dokumenten einer unentwickelten, unbedachten Sprache). Und das kann, von den Zwängen des Mediums abgesehen, auch gar nicht anders sein, denn unsere Schüler sind überfordert, in Auswertung des ihnen zugänglichen und verständlichen Materials - im Falle der Sozialversicherungen beispielsweise: der Werbebroschüren der Versicherungsträger sowie des Werbematerials der Bundesregierung bzw. des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales - mehr als Oberflächliches zu reproduzieren, folglich auch zu präsentieren. Das heißt: Sie sind ihren „Einsagern” ( HANDKE 1967 ) ausgeliefert und erlegen. „Ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist”: so brach es aus HANDKE`S „Kaspar” heraus, in leichter Abwandlung jenes Satzes, den der historische Kaspar Hauser auf dem Unschlittplatz ganz in der Nähe unseres Tagungsortes hier in Nürnberg am Pfingstmontag des Jahres 1828 kaum verständlich zwei verschreckten Bürgern vorgetragen und mit dem er sich Einzug in die Kulturgeschichte verschafft hatte. HANDKE`S Kaspar erliegt seinen Einsagern; unsere Schüler sind den medialen Einsagern unserer Tage erlegen - den smarten Werbebroschüren, den kurzen Lehrbuchauszügen sowie ihren medialen Vorbildern (dazu mehr im nachfolgenden Abschnitt „Der Akt der Präsentation”).
Einhalt! werden Sie nun womöglich denken. Das geht zu weit. Hier wird doch die falsche Frage beantwortet. Es mag ja sein, dass der berufs- und allgemein bildende Gehalt dieses Unterrichts gering ist, dass vornehmlich geläufige Grafiken und Zusammenfassungen oberflächlich reproduziert werden, meinetwegen auch, dass die besten Plakate wie zeitraubend verkleinerte Tafelbilder oder vergrößerte Unterrichtsmitschriften daherkommen mögen. Aber das Thema dieses Vortrags lautet doch „Präsentation und Sprach entwicklung”. Das stimmt. Selbstverständlich ist in den Stunden der Präsentationsproduktion in den Gruppen viel gesprochen worden - von den jeweiligen Wortführern viel, von den Wortkargen merklich weniger, während die Schweigsamen in ihrer Schweigsamkeit weiter verstärkt worden sein werden - klassische circuli vitiosi, klassische Teufelskreise also (wenn auch mit jenen Ausnahmen, die die Regel bestätigen). Aber was hatten die Schüler - unabhängig vom jeweiligen Sprachgefälle in den Gruppen - bei diesen Gesprächen sprachlich lernen können?
Nun ja, Schüler sprechen sehr wohl eh schon außerhalb des Unterrichts - dort übrigens sogar wesentlich mehr. Warum entwickeln sie ihre Sprachkompetenz bei den vielen und langen Sprechgelegenheiten außerhalb des Unterrichts nur so beschränkt weiter? Weil sie sich dort regelmäßig nicht mit differenzierten Problemen auseinandersetzten müssen. Differenzierte Sprache, differenziertes Verstehen - das ist doch wohl mit Sprachkompetenz gemeint - setzt differenzierte Auseinandersetzung voraus. Dieser Sachverhalt entspricht im Kleinen, im Individuellen, der Gattungsentwicklung. Aus dem vorvorigen Jahrhundert stammt dazu ein luzider Aufsatz mit dem Titel „Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen” (Sie werden den Verfasser kennen, es war Friedrich ENGELS ), während in jüngster Zeit die Yanomani-Indianer von diesem grundlegenden Zusammenhang beredtes, neues Zeugnis abgelegt haben. Wie erinnerlich, traten sie vor etwa zehn Jahren für kurze Zeit aus den Tiefen des verbliebenen brasilianischen Urwaldes in das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, weil sie a) ausgerottet zu werden drohten (das alleine hätte ihnen allerdings nicht das plötzliche Interesse der Weltöffentlichkeit gesichert) und weil sich b) herausstellte, dass ihr Zahlensystem nur drei Elemente enthält: Eins, zwei, viele. Ihr Lebensraum, der Urwald, ist von überquellender Fülle, ein differenziertes Zählen lohnt da nicht. Ganz anders die Buschmänner der Kalahari: Sie unterscheiden genauestens, ob es drei oder vier Oryxe sind, deren Spur sie verfolgen. Die Eskimos dagegen unterscheiden durch je eigene Worte 14 Arten von Schnee in ihrer Sprache; ein Wort für „Baum” fehlt ihnen dagegen. (Die Schweden gar kennen bis heute kein Wort für „Nachhilfeunterricht”, und es ist zu befürchten, dass sie nie eins kennenlernen werden.)
Zurück in die heimische Berufsschule. In den Gruppengesprächen wird es über weite Strecken um Alltagsprobleme gegangen sein: Arbeitsaufteilung, Schriftaufteilung auf dem Plakat, enumerative, ungewichtete Aufzählung einfacher Sachverhalte („gelb wirkt so und so”, „die Krankenversicherung leistet dies und das...”). Damit sich die Sprachkompetenz unserer Schüler entwickelt, müssen sie sich jedoch in angemessener, begriffssprachlicher Weise mit angemessen differenzierten Problemen auseinandersetzen. Wo Letzteres fehlt, findet Ersteres nicht statt. Aus diesem Grund enthält eine Antwort auf die Frage nach dem fachlich-methodischen Zugewinn immer auch wesentliche Hinweise auf die Frage nach dem Zugewinn an Sprachkompetenz. Und umgekehrt: Ohne ein bestimmtes Niveau an Sprachkompetenz, an Begrifflichkeit, Ausdrucks- und Verständnisvermögen können fachlich-methodische Probleme nicht begriffen werden, denn Begriff kommt von begreifen. Deshalb ist „die Sprachfähigkeit ‘das wichtigste intellektuelle Werkzeug' und ... als die wichtigste Schlüsselkompetenz einzustufen...” (nochmals GRUNDMANN 2007a, 3), „Sprechen und Denken sind eins” ( Karl KRAUS) .Trotzdem sind die Zusammenhänge zwischen Sprach-, Fach- und Methodenkompetenz hochkomplex. Aber wo es, wie hier, an den einfachsten Voraussetzungen, an neuen, sachangemessenen Aufgabenstellungen nämlich, mangelt, da brauchen die komplexen Zusammenhänge erst gar nicht mehr zu interessieren.
Die weiteren Phasen des Präsentationsunterrichts beanspruchen wesentlich weniger Zeit als die Produktionsphase. Auch wir können sie wesentlich kürzer abhandeln.
Nehmen wir die Farbgestaltung: Die Gruppe hat ihr Plakat gut sichtbar aufgehängt, jedes Gruppenmitglied hat eine Farbe übernommen, hat die Stichworte, die auf dem jeweiligen Plakat verzeichnet sind, in Sätze gekleidet und hat ihr Plakat mehr oder weniger frei erläutert. Der Akt der Präsentation wird vermutlich zwischen zehn und zwanzig Minuten pro Gruppe dauern, d. h. pro Präsentierendem zwischen 2,5 und 5 Minuten.
Diese Zahlen sprechen für sich. Denn eine entscheidende Erweiterung der Sprachkompetenz kann nicht im Minutentakt gelingen. Vielmehr wird hier in der Regel lediglich Vorhandenes vorgezeigt, womöglich auch verstärkt: Wortführer sprechen gewandt und Wortkarge bleiben verhalten (Ausnahmen bestätigen die Regel). So ist es nun einmal leider: Die Turbo-Schule ist noch nicht erfunden - fast school ist wie fast food; sie produziert Wegwerfprodukte, u. U. sogar gefährliche. Dass der Vorgang der Präsentationsproduktion in der Schule obendrein arg zeitraubend war, erhöht den Widersinn. Deshalb hier nur Stichpunkte:
• Die Ausführungen der Schüler kreisen mehr oder weniger pleonastisch um die Stichworte ihrer Präsentationsmedien herum.
• Die Spannbreite der Schülerauftritte reicht von excellent bis herumstammelnd.
• Ihr Auftreten und Gebaren während der Präsentation orientiert sich nicht selten an dem der Stars aus den Fernsehshows. Die nämlich haben die Agierenden - Berufsschüler, oft auch ihre Lehrer - bewusst oder unbewusst vor Augen.
• Nicht selten wird aus Fachbüchern, Broschüren etc. Unverstandenes referiert und entsprechend hilflos gestammelt. Oder es wird einfach die Zusammenfassung vorgelesen.
• Differenziertes lässt sich nicht auf weniges reduzieren, und unsere Schüler sind überfordert, das Fehlende im Vortrag zu ergänzen.
• Differenziertes in Sinne eines „Zwar - Aber” ist zwar nicht theoretisch, wohl aber praktisch ausgeschlossen. Als Beweis dafür möge der folgende Präsentationsnachlass dienen; er fällt gleich zweifach aus dem Rahmen des Üblichen, denn er besitzt erstens einen durchgearbeiteten Text, und darin taucht zweitens - völlig ungewöhnlich - ein leibhaftiges „Zwar” auf (s. Abb. 2, unten). Bitte schauen Sie, es geht um ein Plakat aus der beliebten Serie „Arbeitsplatzgestaltung”: „Sehr geehrte Mitarbeiter/innen [ohne Zeichen weiter] Sie haben mit Sicherheit auch eine Klimaanlage in Ihrem Büro! Sie kühlt zwar im Sommer, wärmt im Winter...” Welch freudige Überraschung, zwar fehlt dem Zwar das Aber, aber das kann man sich denken: „... wärmt aber im Winter.” Indes, nach kurzem Bedenken kommen Bedenken: Eine Klimaanlage gleicht die Temperatur aus, deshalb kühlt sie im Sommer und wärmt im Winter - zusammen mit seinem klandestinen Aber entpuppt sich das prächtige, differenzierende Zwar bei näherem Hinsehen als ein bloßes, apokryphes Und. Jammerschade! Doch wieder nur Auflistung, widerspruchsfrei! Gleichwohl: Etwas Elaborierteres haben wir bislang nicht zu Gesicht bekommen. Am Rande sei vermerkt: Bei dieser „Hausmitteilung” ist der Adressat unbedacht geblieben - Mitarbeiter ersetzen weder „Fassaden durch Fenster” [?], noch lassen sie „bauphysikalisch gestalten”, was auch immer das sein mag...
• Etwaige sprachliche Niveaumängel werden, wie ebenfalls an Abb. 2 mehrfach ersichtlich, nicht durch korrigierende Lehrer ausgeglichen; falsche/missratene/unsinnige Sätze bleiben stehen und prägen sich über die monatelang im Klassenraum herumhängenden Präsentationshinterlassenschaften als richtig, gar beispielhaft ein.
• Es wird nicht gelernt, in Sätzen zu denken, denn für Präsentationsmedien sind Stichpunkte bzw. Kurzaussagen angesagt. Die drei klassischen Ingredienzien der Syntax (Subjekt, Prädikat, Objekt) stellen gewöhnlich schon den Gipfel der Komplexität dar.
• Mangelnde Kenntnisse über visuelle Kommunikation führen nicht selten zu unübersichtlichen, merkstoffüberhäuften Präsentationsmedien.
• Die Schüler denken zunehmend in Bildern, also konkret, unveränderlich, weniger in Sprache, also weniger flexibel, interpretierbar.
• Speziell zu Power-Point-Präsentationen: Die Schüler verzetteln sich mit programmtechnischen Nebensächlichkeiten, während unter der Hand eine glatt polierte, zerhackte Stichwortsprache zum Ideal erhoben wird, in der für Nachdenklichkeiten kein Platz ist. Die innere Struktur des Programms nämlich ignoriert Kausalitäten und Widersprüche, zwingt statt dessen die Gedanken in vorgegebene Raster, am liebsten der Sorte „Soll - Ist - Empfehlung”, und schläfert über all dem obendrein die Zuhörer ein. Statt des gesprochenen Wortes herrscht das verlesene Stichwort.
Um dem Vorwurf der Einseitigkeit entgegenzutreten, sei hier auch Positives vermerkt:
• Die Schüler üben sich darin, vor einer Gruppe zu stehen und etwas vorzutragen.
• Sie üben sich darin, im Team zu Kompromissen zu gelangen.
• Kreative, gestalterische und spielerische Fähigkeiten der Schüler können grundsätzlich entfaltet werden.
Der Tatbestand, dass sich sprachschwache Schüler gegen das Präsentieren in der Regel offen oder heimlich sträuben, zeigt jedoch, wie sensibel sie ihre eigene Schwäche erkannt haben. Sie zu Präsentationen mit selbst erstellen Medien zu zwingen, ist bedenklich. Sie anschließend zu loben, etwa: „Sie haben sich doch nach vorne getraut!”, kommt einer Verhöhnung nahe. Dass es so nicht gemeint war, rettet die Situation nicht - gut gemeint ist bekanntlich das Gegenteil von gut. Diese Schüler werden denken, u. U. sogar fragen: „Warum soll ich hier präsentieren? Ich bin doch kein Lehrer! Ich will auch nicht Politiker werden, sondern Gärtner, Chemielaborant, Fensterbauer, Mechatroniker, Sachbearbeiter, Buchhalter!” Was entgegnen wir? Ist die Einstellung der Schüler, ihr realistisches Anspruchsniveau (einschließlich der realistischen Einschätzung ihres beruflichen Anforderungsprofils) nicht sogar ein wichtiger, gemeinwohldienlicher Wert, den man zu pflegen statt zu zerstören trachten sollte? Hier an unserem Tagungsort, in der Stadt des HANS SACHS, wird der Satz bekannt sein: „Schuster, bleib' bei deinen Leisten!” Trotz seiner Einseitigkeit enthält er auch Wahrheit. Dafür haben sich viele Schüler ein Gespür erhalten; wer beispielsweise als Produkt einer Präsentation eine Hausmitteilung nach Art der präsentierten vorgelegt hat, der wird Verschriftlichungen weiterhin aus dem Wege gehen, wo er nur kann („Simsen” ausgenommen).
Wir kommen zum letzten Akt des Präsentationsunterrichts, der Reflexion.
Im Allgemeinen laufen Präsentationen nach dem Schema ab: Schüler präsentieren, ihre Mitschüler hören zu und klatschen Beifall am Ende. Es gibt sogar viele Lehrerbildungsseminare, in denen ausdrücklich angeraten wird, notfalls von Lehrerseite aus als Einklatscher, als animateur des claqueurs, zweifellos ein entfernter Verwandter der Einsager, initiativ zu werden. Der Applaus fällt ausnahmslos auch in Abhängigkeit von der Sympathie aus, welche die Präsentierenden bei ihren Mitschülern genießen. Auch dies entspricht den Gepflogenheiten der Fernsehshows.
Wenn der Lehrer die Regeln des zuvor von uns als Abb. 1 präsentierten Rezeptbogens „So gelingt jede Gruppenarbeit” einhält, wird er die Mitschüler zur Präsentationsbeurteilung animieren können. Nach eigenen Erfahrungen sowie nach allem, was wir gehört und gesehen haben als anleitende Lehrer, Seminarleiter, Teamlehrer, Unterrichtspraktikantenbetreuer u.ä., sind Mitschüler durchaus gute Beobachter und tragen ihre Würdigung (Lob, Tadel, Verbesserungsvorschläge) in der Regel für ihre Mitschüler nachvollziehbar vor. Allerdings konzentrieren sich ihre Beobachtungen nahezu ausnahmslos auf Formales, eben die Kriterien des vorangegangenen Rezeptbogens aus der Lehrerfortbildung („Lautstärke, Betonung, Körpersprache, Blickkontakt zur Klasse, Wortwahl, hat jeder präsentiert?”: s. Abb. 1).
Solche Rückmeldungen sind nicht unbedeutend, denn ein Schüler erhält sie sonst kaum je. Einen Beitrag zur Entwicklung von Sprachkompetenz leisten sie jedoch allenfalls in Hinblick auf Sprechtechnisches, wobei die Feedgebackten selbst solche Verbesserungsvorschläge kaum einfach, gewissermaßen ruckzuck, umzusetzen in der Lage sein werden (mehr dazu nachfolgend).
Der Lehrer tut gut daran zu warten, bis die Klasse ihre Reflexion beendet hat, und sich auf wenige, ergänzende Bemerkungen zu beschränken. Die Gruppendynamik der Situation bewirkt, dass Lehrer jetzt in der Regel Lobendes, nicht selten über Gebühr und undifferenziert Lobendes, sagen werden, Tenor: „Das war ja ganz toll!”
Häufig werden Präsentationen auch vom Lehrer benotet. Da die Präsentationsbeurteilung aber im Gegensatz zur Klassenarbeit der erwähnten Gruppendynamik unterworfen ist, erbringt sie in vielen Fällen bessere Noten (die Noten „4”, „5” und „6” beispielsweise sind faktisch ausgeschlossen). Das erhöht verständlicherweise die Akzeptanz des Präsentationsunterrichts bei den Schülern.
Wie der Lehrer nach einem Unterrichtsbesuch, so können nunmehr die Schüler die Güte ihrer Präsentation selbst einschätzen und vortragen, am besten noch vor der Manöverkritik durch Mitschüler und Lehrer. Dies ist eine Chance, die dem Präsentationsunterricht eigen ist. Davon zu unterscheiden ist die Selbstreflexion auf dem Nachhauseweg, also nach der Manöverkritik. Darüber kann nur spekuliert werden. Bestenfalls kann über die Wirkung aller Reflexionen zusammengenommen dort etwas ausgesagt werden, wo einzelne Schüler mehrfach präsentieren. Die Ergebnisse sind wenig überzeugend, denn kaum je sind Verbesserungen, gar Beseitigungen kritisierter Verhaltensaspekte bei der späteren Präsentation zu verzeichnen. Das heißt: Der Zuwachs an Präsentationskompetenz ist bescheiden - wer vorher nicht frei sprach, keinen Blickkontakt aufnahm etc., der tut es beim nächsten Mal auch (noch?) nicht.
Diese Beobachtung kann nicht überraschen. Denn derartige Verhaltensverbesserungen berühren den Kern der jeweiligen Persönlichkeit. Sie sind deshalb alles andere als leicht zu variieren, geschweige denn einfach im Vorübergehen zu verbessern. Aus bildungsökonomischer, d. h. kostenrechnerischer Sicht ist eh zu diagnostizieren: Die Qualitätssicherungs-, vor allem aber die Opportunitätskosten dieses Unterrichts sind inakzeptabel. Sie werden nicht annähernd durch seine Leistungen gedeckt.
Wir kommen zum Schluss. Für gleiche Fachinhalte braucht Präsentationsunterricht aus einsichtigen Gründen ausnahmslos erheblich mehr Zeit als ein gut geplanter, herkömmlicher Unterricht. Zeit aber ist ein knappes Gut. Zusätzlich wird Präsentationsunterricht - wiederum aus einsichtigen Gründen - regelmäßig einhergehen mit einer Verflachung, eine Minderung der fachlichen „Eindringtiefe” ( RÖLKE /RÖSSLER ) des Unterrichts. Dass eine Verflachung des Unterrichts zu einer Vertiefung der Sprachkompetenz führt, widerspricht allen Regeln der Erfahrung und des Verstandes. Denn worin anders soll sich Sprachkompetenz erweisen als in der sprachlich exakten Erfassung und Vermittlung berufs- und allgemein bildender Sachverhalte?
Insofern gilt: Ein Unterricht, der die Fach- und Methodenkompetenz der Schüler entwickelt, entwickelt uno actu ihre Sprachkompetenz. Dies erweist sich erfahrungsgemäß nicht zuletzt auch immer wieder daran, dass (fachlich) gute Berufsschüler ihren 15-minütigen Vortrag/ihre Präsentation im mündlichen Teil der IHK-Abschlussprüfung regelmäßig gut gestalten, gelegentlich sogar mit Bravour, während schwache Schüler ihren Vortrag überwiegend eher schwach gestalten. Diese Aussage kann an Hand der jeweiligen Noten prinzipiell empirisch überprüft werden. Kurz: Wer etwas zu sagen hat, kann es im Allgemeinen auch, und wer es nicht kann, der hat es in der Regel auch nicht: „So lieb ist der liebe Gott nun auch wieder nicht, dass er dem, der keinen Inhalt hat, die Form schenkt.” ( ALFRED HRDLICKA ) Die Umkehrung dagegen gerät zum Ärgernis – HANS DAMPF , der lockere Sprecher, der nichts zu sagen hat. Nix kapiert, aber präsentiert: Wollen wir so etwas fördern in der (Berufs-) Schule?
Damit wir nicht missverstanden werden: Mit der Feststellung des engen Zusammenhangs zwischen Fach-, Methoden- und Sprachkompetenz ist einer einseitigen, scheuklappenmäßigen Fachausrichtung des Unterrichts keineswegs das Wort geredet. Vielmehr kann Fachunterricht, wie allgemein bekannt, methodisch höchst unterschiedlich gestaltet werden. Erstrebenswert ist ein fachlich-inhaltlich bestimmtes Unterrichtsarrangement, das, wohl bedacht, einen Beitrag zur simultanen Förderung von Methoden-, sozial-kommunikativer und Sprachkompetenz leistet. Das ist jedoch ein anderes Thema. Unsere Positionen dazu haben wir an anderen Stellen systematisch dargestellt (s. z. B. STOMMEL/ STOMMEL 1998 a; STOMMEL 1983, 1995, 1998c).
Dort, wo Förderung der Sprachkompetenz explizit Unterrichtsthema ist, im freilich gar nicht mehr an allen Berufsschulen vertretenen Unterrichtsfach „Deutsch” (bzw. neudeutsch: „Kommunikation”), wird jedoch, anstatt die spärliche Zeit für Vortrags- und ähnliche sinnvolle Übungen zu nutzen, das kostbare Gut „Unterricht” nur allzu oft in erheblichem Umfang schlicht vertan - mit Rechtschreibdingen nämlich. Auch das ist ein Kapitel für sich, und auch dazu haben wir unsere Position an anderen Stellen systematisch dargestellt und begründet (für Einzelheiten s. z. B. STOMMEL/ STOMMEL 1998 b; STOMMEL 2004 , 2008).
Auf diese Schranke aufmerksam zu machen, ist dringendes Gebot. Wir alle kennen die „grässlichen” Pisa-Studien zu Genüge. Jahr für Jahr wird uns von Pisa & Co. eine weltweit einmalige, „offensichtliche Vererbbarkeit der Bildungsarmut bzw. des Bildungsreichtums” ( GRUNDMANN 2008, 11) bescheinigt, und immer von Neuem führen uns derlei Studien vor Augen, dass wir alljährlich „25% der Schulabsolventen als nicht ausbildungsfähig bzw. als nicht ‘berufsreif'” ( GRUNDMANN 2007b, 397) in die Perspektivlosigkeit entlassen. Wenn wir diesen Zustand ernsthaft verbessern wollen, so werden wir nicht umhin kommen, die Mitverantwortung der deutschen Orthografie endlich zu erkennen bzw. anzuerkennen. Ihre Nichtanerkennung wird auf Dauer genauso unhaltbar wie weiland die Hallstein -Doktrin.
Der Grund müsste nachvollziehbar sein: Den Weg in die sprachliche Zwei-Klassen-Gesellschaft mit Sprachbesitzern, das heißt mit sicheren Schreibern, freien Sprechern und Einsagern hier oben sowie mit einer Art verbalem Prekariat da unten, nicht zuletzt in den Berufsschulen, unfähig, sich differenziert auszudrücken und Texte zu verstehen, die über das Niveau von Boulevardpresse und „Unterschichtfernsehen” ( Harald Schmidt) hinausgehen, mit Menschen, die, ihrer mit roter Tinte getränkten schulischen Leidensgeschichte eingedenk, das Schreiben meiden wie der Teufel das Weihwasser: Den Weg in diese sprachliche Zwei-Klassen-Gesellschaft können wir uns am Standort Deutschland nicht leisten - weder wirtschaftlich noch politisch, und menschlich schon gar nicht.
Obwohl auch uns nicht entgangen ist, dass seit 2007 wieder „Rechtschreibfrieden” (HANS ZEHETMAYER u. a .) eingekehrt ist in deutschen Landen, und obwohl auch wir friedliebende Menschen sind, schließen wir deshalb unseren Vortrag trotzig (und scheinbar völlig unzeitgemäß) nach Ciceros klassischem Vorbild: „Im Übrigen sind wir der Meinung, dass die deutsche Rechtschreibung vereinfacht werden muss.”

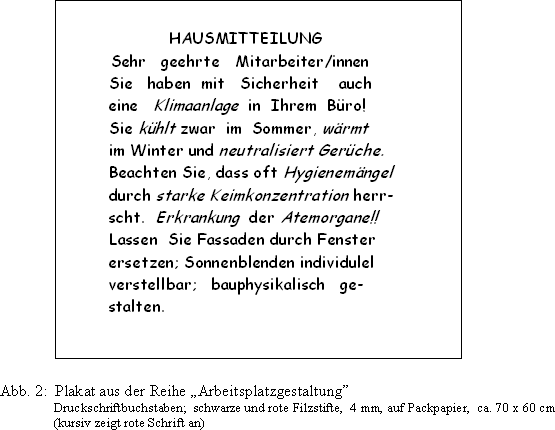
GRUNDMANN, H. ( 2007a): Die Berliner Antwort auf die zunehmende Sprachlosigkeit der Jugendlichen: Entwicklung eines Sprachförderkonzeptes zum Erwerb der Berufsfähigkeit. In: Winklers Flügelstift, Nr. 2/07, Darmstadt.
GRUNDMANN, H. (2007b): Zur jüngsten OECD-Studie ‘Bildung auf einen Blick 2007': Mehr als eine Studie auf den ersten Blick. In: Wirtschaft und Gesellschaft, Nr. 12, Wolfenbüttel.
GRUNDMANN, H . ( 2008): Das deutsche Bildungssystem - eine Erfolgsstory ohne Ende oder vor dem Ende?. In: Winklers Flügelstift, Nr. 1, Darmstadt.
HANDKE, P. (1967): Kaspar - Ein Sprechstück, Frankfurt a. M.
STOMMEL, A. (1983): Schüler drehen einen Film im Fachunterricht - Eine Unterrichtskonzeption zur Förderung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz, Lehrfilm mit schriftlichem Begleitmaterial, München: Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht.
STOMMEL, A. ( 1995): Handlungsorientierter und traditioneller Unterricht - Aus dem Labyrinth der Unmittelbarkeit, Rinteln.
STOMMEL, A./ STOMMEL, M. (1 998 a): Vom Lehren in Zeiten der Leere, 2 Bände, Darmstadt.
STOMMEL, A./ STOMMEL, M. ( 1998 b): Betong oder die orthografische Standortsicherung - Deutschland, deine Rechtschreibung. Hamburg.
STOMMEL, A. (1998 c): Lernfeldorientierte Rahmenlehrpläne: Amtliches Durcheinander als neue Ordnung des Unterrichts - Ein Bericht aus einer wundersam verkehrten Welt des Zufalls, Beiheft zu Winklers Flügelstift Nr. 2/98. Darmstadt.
STOMMEL, A. (2004): Pisa und die deutsche Orthografie - Über ein heimliches Verhältnis und seine Folgen für den Deutschunterricht an berufsbildenden Schulen, in: GRUNDMANN, H. (Hrsg): Der Deutsch- und Fremdsprachenunterricht zwischen Lebensbezug und Berufsbezug - 13. Hochschultage Berufliche Bildung 2004. Bielefeld.
STOMMEL, A. ( 2008): Pisa, Rütli & unsere Orthografie, unveröffentlichtes Manuskript.